28 Apr. Gedanken am 28.4.2020 – Eigener Lebensbereich und das Gemeinwohl
Verhältnismäßig oder übertrieben?
Die sechs Wochen des außerordentlichen Zustands empfinden viele als sehr, sehr lange – gefühlsmäßig vielleicht eher wie sechs Monate als sechs Wochen. Die Zahl der Infektionen in Österreich geht immer weiter zurück, und die meisten Leuten kennen niemanden persönlich, die infiziert oder einen schwereren Verlauf hatten. Darum werden sich viele wohl fragen, ob die strengen Maßnahmen notwendig waren, oder ob die Gegner dieser Maßnahmen doch Recht hatten, ob das alles nur eine unnötige Panikmache war.
Angst schüren?
Gerade zu diesem Zeitpunkt kommen Informationen heraus, die darauf hindeuten könnten, dass der Bevölkerung bewusst Angst gemacht wurde (wohl um sie zu motivieren, vorsichtig zu sein oder Vorsichtsmaßnahmen zu akzeptieren) ( https://www.meinbezirk.at/wieden/c-politik/bevoelkerung-soll-angst-vor-ansteckung-haben_a4046607)
Ob einige in der Regierung absichtlich Angst verbreiten wollten, weiß ich nicht und ich will keine Meinung dazu äußern; möchte aber auf eine Grundproblematik hindeuten, die Politiker dazu bewegen könnten, und die auch für uns alle eine Herausforderung darstellt.
Nicht für sich selbst, sondern für das gesamte Volk.
Die Entwicklungen in Italien, Spanien, New York (wo in einem Monat insgesamt viermal so viel Menschen gestorben sind als im Durchschnitt, vielmehr als bei der schlimmsten bisherigen Grippewelle) zeigen, dass es schlimm werden kann. Und dass die Zeitspanne zwischen dem Moment, wo für eine einzelne Person das persönliches Risiko sehr gering ist, und dem Moment, wo das gesamte Gesundheitssystem überfordert wird, unglaublich kurz ist, einige wenige Wochen.
Das stellt eine unglaublich große Herausforderung für die Leitung einer Gesellschaft bzw. eines Staates dar. Denn sie muss es schaffen, dass das Volk akzeptiert oder sich zu eigen macht, Maßnahmen, die im Blick auf die gesamte Gesellschaft verhältnismäßig sind, die aber nur im Blick auf die jeweils persönliche Situation, weit übertrieben wären.
Ich habe gestern beispielhaft ausgerechnet, in etwa wie groß bzw. gering die Gefahr eines Besuches darstellt, auch bei jemandem, der oder die zu einer Risikogruppe gehört. Die Gefahr eines Besuches bei gesunden jüngeren Freunden ist natürlich noch viel weniger. Wenn alle Personen immer nur auf das eigene Risiko geschaut hätten, dann hätte weitgehend nicht auf Besuche, Veranstaltungen, usw. verzichtet werden müssen, weil das persönliche Risiko immer noch relativ gering war. Bis aber zu dem Zeitpunkt, wo jeder vernünftigerweise größere Sorge um sich selbst oder seine Familien/Freunden/Kollegen haben müsste, wäre das Gesundheitssystem schon überfordert gewesen.
Wie kann man Personen motivieren, zugunsten des gesamten Volks zu handeln?
Um das gesamtgesellschaftliches Übel einer weiten Ausbreitung oder der Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern, müssen Leuten Vorsichtsmaßnahmen treffen bzw. annehmen, die übertrieben wären – nur im Blick auf die Gesundheit ihrer Freunde, Familie, und Kollegen, die gerechtfertigt, nur im Blick auf die Verhinderung einer Ausbreitung insgesamt sind.
Wie kann es sein, dass z.B. Essen gehen in einen Lokal mit der eigenen Familie ein nicht nennenswertes Risiko für meine Familie darstellt, und gleichzeitig ein relevantes Risiko für die gesamte Bevölkerung bringt? Auch wenn es rechnerisch belegt werden kann, kann man es sich sehr, sehr schwer vorstellen.
Angst als Motivationsmittel?
Wie bringt man also Personen dazu, Maßnahmen zu akzeptieren und selber zu setzen, die für die Gesellschaft wichtig sind (wo aber der Grund dafür nicht leicht nachzuvollziehen ist), aber für die Personen selbst unnötig wären? Ein Weg wäre es wohl, auszumahlen, was kommen könnte, wenn man keine Maßnahmen ergriffe, um so Angst zu erregen, die zur persönlichen Vorsicht und Akzeptanz der verordneten Maßnahmen motiviert. Es wäre verständlich, wenn Politiker dazu greifen würden.
Diese Angst bringt aber zwei Probleme mit sich. Zum einen, führt sie zum menschlichen Leiden. Viele Personen leiden unter Angst, und leiden auch aufgrund von Entscheidungen, die aus Angst getroffen werden. „Aus Angst vor dem Tod wird Angst vor dem Leben“; so habe ich schon vor einem Monat auf diese Gefahr hingedeutet. Wenn jemand z.B. Monate lang alle Kontakt vermeidet, obwohl man unter extremer Einsamkeit leidet, dann nimmt man sich selber nicht wenig an Lebensqualität. Solche Einsamkeit kann auch die Lebenserwartung verringern, vielleicht mehr als die Gefahr einer potentielle Ansteckung es tun würde.
Zum anderen, wenn jetzt Maßnahmen aus Angst ergriffen oder akzeptiert werden, hat man im Nachhinein ein Problem. Wenn die Maßnahmen greifen, dann scheinen die Maßnahmen im Nachhinein übertrieben gewesen zu sein. Das Virus war eh nicht so gefährlich, warum haben wir so lang auf so vieles verzichtet bzw. verzichten müssen? In den USA haben Epidemiologen schon in Februar und März darauf hingewiesen, es müssten Maßnahmen getroffen werden, die im Nachhinein völlig übertrieben erscheinen werden — weil die Maßnahmen eben das verhindert haben, was sie verhindern sollten, die drastische Ausbreitung der Krankheit.
Dieses Gefühl, das die Maßnahmen in Österreich übertrieben waren, birgt die Gefahr, dass auf breiter Basis die Sorgsamkeit um Ansteckung zu vermeiden zurückgeht, dass zu wenig Akzeptanz für behördlich verordnete Maßnahmen vorhanden sein wird. Daraus könnte mit großer Wahrscheinlichkeit eine zweite Infektionswelle entstehen, schlimmer als die erste.
Wie gehen wir jetzt mit der Situation um?
Folgende Schritte wären meines Erachtens gut, sowohl persönlich wie auch medial und auf der politischer Ebene. Auch auf kirchlicher Ebene, soweit die Kirche als Institution handelt.
- Daran zu denken bzw. daran zu erinnern, vielleicht auch anhand von erhobenen Daten zu belegen: Es ist weder Zufall noch Schicksal, dass Österreich weniger betroffen wurde als Italien, Spanien, Schweden, Teile von den USA, sondern weil Österreich im Verhältnis zu den Zahlen einige Tage früher gehandelt hat. Womöglich wurde die Maßnahmen auch besser akzeptiert, was dazu beigetragen würde, dass Österreich besser da steht als manche andere Länder (ein Verbot, sich zu versammeln, bringt wenig, wenn sie weitgehend missachtet wird). Die Maßnahmen waren also nicht unnütz, sondern haben eben ihren Zweck erfüllt.
- Wir müssen/sollten die nächsten Monate weiterhin Dinge tun oder unterlassen zugunsten des Gemeinwohls und der gesamten Gesellschaft, die komplett unnötig und übertrieben erscheinen und es auch wären, wenn wir unser persönliches Risiko betrachten würden.
- Wir müssen, als einzelne und als Gesellschaft, aber nicht nur Gesundheitsrisiken, sondern auch die psychischen, wirtschaftlichen und anderen menschlichen Risiken im Auge behalten und abwägen, die strikten Einschränkungen mit sich bringen.
- Man kann nicht mit Verordnungen jeder Situation gerecht werden. Wir müssen uns verstärkt auf Bewusstseinsbildung und Eigenverantwortung setzten.
- Wir haben kein unmittelbares Gespür dafür, wie viel Einschränkung nötig ist, um einen erneuerten Krankheitsausbruch zu verhindern. Am besten wäre es, wissenschaftlich begründete und flexible Empfehlungen zu haben, die jeder selber dann anzupassen hätte im Blick auf die eigene Situation. Nur als Beispiel: wer im „normalen Leben“ in engeren Kontakt mit mehr als 5 Personen wöchentlich kommen würde, sollte nach einer Halbierung streben, nur halb so viele enge Kontakt, maximal 10. (Die konkreten Zahlen habe ich nur für das Beispiel aus der Luft gegriffen, ich weiß nicht, ob das zu wenig oder zu viel Einschränkung wäre.)

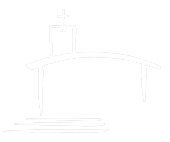

Heinz Hödl
Posted at 09:01h, 28 AprilLieber Joseph, bin voll mit deinen Überlegungen einverstanden. Denke jedoch darüber noch nach.
Heinz Hödl
Posted at 16:20h, 28 AprilIn 1967 hat der Amerikaner Stanley Milgram ein Experiment durchgeführt: Er verteilte Pakete am zufällig ausgewählten Personen mit der Bitte sie an einer ganz bestimmten Person zu senden, allerdings mit der Regel: das Paket nur an Leute weiterzuschicken die man persönlich kennt und die sollen es ebenfalls so machen. Viele dieser Pakete kamen an, meistens waren nicht mehr als 3-6 Zwischenstationen notwendig. Das zeigt wie eng wir vernetzt sind. Menschen an völlig unterschiedlichen Orten, die fast gar nichts gemeinsam haben, sind durch eine ziemlich kurze Kette persönlicher Bekanntschaften miteinander verbunden. In der Pandemie sehen wir die negativen Seitens dieser Vernetztheit: Sehr leicht passiert es, dass man jemanden die Hand schüttelt, der von jemandem abgehustet wurde, der jemanden getroffen hat, der in Ischgl war.